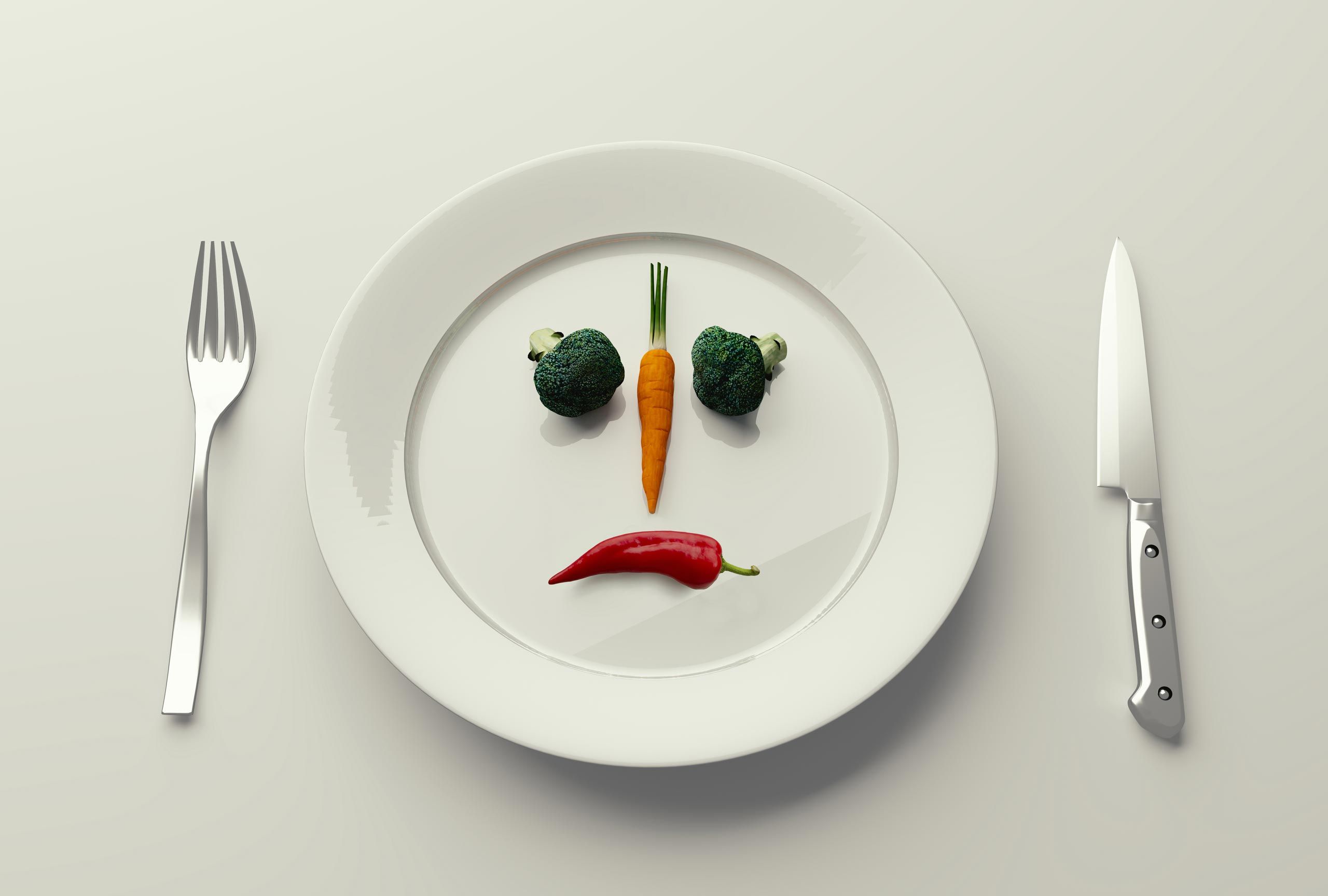
Österliche Bußzeit – mehr als nur Fasten
Ab Aschermittwoch bereiten sich gläubige Christinnen und Christen auf Ostern als wichtigstes Fest des ganzen Jahres vor. Rund vierzig Tage dauert diese Zeit und wird meist als Fastenzeit bezeichnet. Der passendere Name für diese Zeit lautet jedoch österliche Bußzeit. Das ist mehr als eine Spitzfindigkeit, denn in dieser Zeit geht es um mehr als Fasten.
Insgesamt drei Dinge werden im Evangelium vom Aschermittwoch (Mt 6,1–6.16–18) den Gläubigen nahegelegt: Fasten, Beten und Almosen geben. Etwas moderner könnte man formulieren: die Beziehung zu sich selbst, zu Gott und zu den Mitmenschen wieder neu ausrichten. Alle drei Handlungen sind nämlich kein Selbstzweck, sondern zielen darauf ab, den Blick wieder stärker auf das Wesentliche zu lenken.
Wie das konkret aussehen kann, möchten wir Ihnen im Laufe der Zeit bis Ostern in mehreren Artikeln vorstellen. Zum Auftakt widmen wir uns dem Fasten.
Das Fasten
Zeitungsberichte und Fernsehsendungen machen rund um Aschermittwoch deutlich, dass das Fasten in den vergangenen Jahren wieder modern geworden ist. Meist steht dahinter der Wunsch, ein bisschen Gewicht zu verlieren oder gesünder zu leben. Das sind ohne Frage vernünftige Motive, spielen aber bei der Fastenzeit im religiösen Sinn nur eine untergeordnete Rolle.
Das Fasten, also der freiwillige Verzicht auf Nahrung oder andere Dinge, stellt in vielen Religionen eine Bußübung, die Vorbereitung auf ein Fest oder gar auf die Begegnung mit Gott dar. So berichtet das zweite Buch der Bibel, dass Mose 40 Tage und Nächte nichts aß und trank, während er die Zehn Gebote von Gott erhielt (vgl. Ex 34,28). Eine Geringschätzung des Leibes ist dabei in der Bibel nicht auszumachen.
Vorbild für die Fastenzeit als Vorbereitung auf Ostern sind die 40 Tage, die Jesus in der Wüste verbrachte, bevor er öffentlich auftrat (vgl. Lk 4,2). Für ihn gehörte Fasten also zu seinem Glaubensleben dazu. Hierin wird auch ein Sinn des Fastens deutlich: wieder näher zu Gott zu finden und aufmerksamer für das zu sein, was Gott mitteilen will.
Doch machte Jesus auch deutlich, dass es nicht darum gehen soll, von anderen für das Fasten gelobt zu werden: „Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler! Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten.“ (Mt 6,16). Fasten ist also eine persönliche Entscheidung. Es kann helfen, bisherige Gewohnheiten zu hinterfragen und neue zu entwickeln, die auch über die Fastenzeit hinauswirken.
Die 40-tägige Fastenzeit nach dem Vorbild Jesu hat sich bis zum 4. Jahrhundert herausgebildet. Schon vorher gab es den Brauch, einige Tage vor Ostern zu fasten. Im Mönchtum entwickelten sich parallel teils sehr strenge Fastenbräuche, bei denen die Mönche über Tage auf Nahrung verzichteten. Der heilige Benedikt bleibt in seiner Ordensregel (RB) vorsichtiger. In der Fastenzeit ist eine tägliche Mahlzeit am Abend vorgesehen (vgl. RB 41). Überhaupt setzt er auf freiwilligen Verzicht: „So möge [in der Fastenzeit] jeder über das ihm zugewiesene Maß hinaus aus eigenem Willen in der Freude des Heiligen Geistes Gott etwas darbringen; er entziehe seinem Leib etwas an Speise, Trank und Schlaf und verzichte auf Geschwätz und Albernheiten.“ (RB 49) Die Formulierung macht auch deutlich, dass es beim Fasten um mehr geht, als nur auf Nahrung zu verzichten. Es geht auch darum, einen anderen Umgang mit seinen Mitmenschen einzuüben.
Vorgeschrieben ist heute in der katholischen Kirche nur noch, am Aschermittwoch und Karfreitag zu fasten, also lediglich eine (sättigende) Mahlzeit einzunehmen. An diesen beiden Tagen ist – genau wie an jedem Freitag des Jahres – der Verzehr von Fleisch untersagt. Und auch diese Regelung gilt nur für gesunde Menschen zwischen 18 und 60 Jahren.
Das bietet viele Freiheiten, eigene Vorsätze für die Fastenzeit zu fassen. Leitend sollte die Frage sein, was bei der Vorbereitung auf Ostern für einen persönlich am besten geeignet ist. Eine Möglichkeit besteht darin, auf etwas zu verzichten, was viel Zeit in Anspruch nimmt, ohne dass es notwendig wäre. Das kann zum Beispiel der Verzicht auf soziale Medien sein. Anfangs kann das zu dem Gefühl führen, etwas Wichtiges zu verpassen oder von anderen vergessen zu werden, wenn man nicht ständig präsent ist. Es kann sich aber auch die Erkenntnis einstellen, dass sich die Welt auch ohne einen weiterdreht und man nicht jedes Ereignis anderen mitteilen muss. So ein Fasten kann auch Zeit eröffnen, sich mit wichtigeren Fragen auseinanderzusetzen, spazieren zu gehen oder jemanden zu besuchen. Dafür sind jetzt (mindestens) 40 Tage Zeit.
Andreas Hahne
